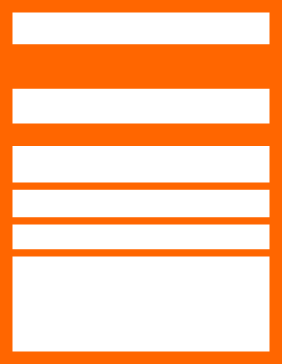Die Regierung verhandelt über das Herzstück der türkis-grünen Koalition. Mit der ökosozialen Steuerreform könnte sie die Trendwende in der heimischen Klimapolitik einläuten
Dreißig Jahre nachdem Schweden die CO₂-Steuer einführte, hecken ÖVP und Grüne ein historisches Papier aus. Die Gespräche zur ökosozialen Steuerreform gehen gerade in die heiße Phase. Für Oktober ist die Budgetrede von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) geplant. Bis dahin sollen die Eckpunkte stehen.
Schon Anfang 2022 soll alles neu werden. So haben es die beiden Parteien im Regierungsprogramm verankert. Für sie steht dabei einiges auf dem Spiel. Die ÖVP könnte nach mehr als drei Jahrzehnten ihr altes Konzept der ökosozialen Marktwirtschaft verwirklichen. Für die Grünen ist die Steuer das Prestigeprojekt, an dem ihre Wähler sie messen werden.
Zehn Fragen zur großen Reform, die Österreich verändern soll.
Warum soll CO₂ überhaupt etwas kosten?
Der Grundgedanke geht auf eine Idee des englischen Ökonomen Arthur Cecil Pigou zurück. Er hat bereits 1920 eine Steuer erdacht, Jahrzehnte bevor die Klimakrise zum politischen Thema wurde. Pigou wollte das Problem lösen, dass Umweltverschmutzung die Gesellschaft schädigt. Als Beispiel dient ein Fabrikant, aus dessen Schlöten giftiger Rauch kommt, der Menschen krank macht. Der Fabrikant fährt Gewinne ein, die Kosten für die Umweltverschmutzung muss aber die Allgemeinheit zahlen -eine klassische Wettbewerbsverzerrung, weil die Allgemeinheit den Fabrikanten indirekt fördert. Die Lösung sah Pigou darin, den giftigen Rauch zu besteuern. In der Fachsprache heißt das: die externen Kosten zu internalisieren. Die Steuer sollte so hoch wie der Schaden sein. Wenn der Fabrikant selbst für diese Kosten aufkommen müsse, bekäme er damit einen starken Anreiz, das Problem zu beheben. Heute ist die Pigous-Idee in Form der Tabak-, Stau-oder CO₂-Steuer umgesetzt. Und Letztere gilt in der Wissenschaft wiederum als größter Hebel, um die klimaschädlichen Gase so rasch wie möglich zu drosseln.
Wird klimaschädliches Verhalten nicht ohnehin schon besteuert?
Nur zum Teil und nicht aus einer klimapolitischen Überlegung heraus. Sechs Prozent aller Steuereinnahmen sind laut Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo Steuern mit Umweltbezug, also insgesamt 8,7 Milliarden Euro (2020). Den Löwenanteil macht dabei die Mineralölsteuer (MÖSt) aus, also das, was der Staat unter anderem beim Tanken kassiert. Die MÖSt spülte selbst im Corona-Jahr 2020 rund 3,8 Milliarden Euro in die Staatskassen. Dennoch stellt Wifo-Ökonomin Angela Köppl fest: „Österreich gehört bei den Umweltsteuern nicht zu den Vorreiter-Ländern.“ Die Republik liegt bei den Umweltsteuern nicht nur unter dem EU-Schnitt, sondern fördert, was die Umwelt schädigt: 2016 schrieb Köppl an einer viel beachteten Studie mit, die zeigte, wieviel Geld der Staat in diese Förderungen steckt. Allein in den Bereichen Energie und Verkehr waren es zwischen 3,8 und 4,7 Milliarden Euro an umweltschädlichen Subventionen.
Ist die CO₂-Bepreisung ein grünes Projekt?
Nicht nur, sondern auch ein ökonomisches. Erst Mitte Juni bewertete der Internationale Währungsfonds die österreichische Wirtschaft. Er stellte ihr zwar ein gutes Zeugnis aus, betonte aber, Österreich brauche eine CO₂-Steuer. Ein Blick über den Tellerrand zeigt, dass in anderen Ländern die CO₂-Steuer auch von konservativen Regierungen vorangetrieben wurde. In Deutschland führte die schwarz-rote Koalition unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die CO₂-Bepreisung ein, in Großbritannien gab die Regierung unter dem konservativen Premier David Cameron CO₂ einen Mindestpreis.
Dass es eine Bepreisung geben muss, betrachten auch die Wirtschaftsforscher in Österreich als Notwendigkeit. Als die türkisblaue Koalition vor zwei Jahren die Eckpunkte der letzten größeren Steuerreform vorstellte, war genau das Fehlen einer Ökosteuer einer der lautesten Kritikpunkte der damaligen Chefs der beiden großen österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitute IHS und Wifo.
Der damalige IHS-Chef Martin Kocher bewertete den Einstieg in die Ökologisierung damals als „zu vorsichtig“ und sagte: „Da hätten wir mutigere Schritte erwartet.“ Die Steuerreform würde nicht ausreichen, „um die Klimaziele zu erreichen“. Heute sitzt Kocher als Arbeitsminister selbst für die ÖVP in der Regierung.
Auch Christoph Badelt warnte als Wifo-Chef, für Österreich werde es teuer, wenn die Republik die CO₂-Ziele verfehle, und meinte, die ÖVP-FPÖ-Regierung würde im Klimabereich nur „ein paar kleine Dinge planen“, mit denen sich die CO₂-Ziele nicht erreichen ließen. Er empfahl, besser jetzt Geld in die Hand zu nehmen, als später Strafe zu zahlen.
Was macht das Versagen in der Klimapolitik so teuer?
Auf diese Frage gibt es zwei Antworten. Erstens schadet der Klimawandel bereits heute der Volkswirtschaft. Anfang des Jahres zogen die Bundesforste Bilanz und meldeten einen klimawandelbedingten Rekordschaden von 48 Millionen Euro. Die zunehmenden Unwetter und Hitzetage treffen auch die Landwirtschaft, laut Hagelversicherung beläuft sich der Schaden heuer bisher auf mehr als 100 Millionen Euro. Das sind nur Schlaglichter, an denen sich Schäden gut illustrieren lassen, das Ausmaß ist allerdings weit größer. In der Studie „Costs of inaction“(Coin) berechneten Ökonomen, wie viel die Klimakrise Österreich kostet, wenn klimapolitisch nicht gehandelt wird. Sie beinhaltet neben Landwirtschaft und Forstwirtschaft auch andere Bereiche wie Tourismus, Naturkatastrophen und den Gesundheitssektor. Das Ergebnis: Schon heute kosten Klima-und Wetterfolgen Österreich zwei Milliarden Euro pro Jahr.
Bis 2030 werden diese Schäden laut Prognose zwischen drei und sechs Milliarden ausmachen, bis 2050 zwischen sechs und 12 Milliarden pro Jahr. „Das sind die Schäden, von denen wir schon wissen und die wir robust quantifizieren können“, sagt Volkswirtschaftsprofessor Karl Steininger von der Uni Graz, der federführend an der Coin-Studie mitschrieb. Dabei bildet die Studie manche große Bereiche wie Biodiversitätsverluste und Kosten durch klimabedingte Flucht und Migration noch gar nicht ab, erklärt Steininger.
Die zweite Antwort, warum fehlende Klimapolitik teuer wird, sind die Vorgaben der EU. Wenn Österreich die Klimaziele verfehlt, muss der Staat das finanziell ausgleichen. „Für den Verpflichtungszeitraum 2021 bis 2030 lagen diesbezügliche Schätzungen vor, die von Ausgaben für den Ankauf von Emissionszertifikaten von bis zu 9,214 Mrd. EUR ausgingen“, hält der Rechnungshof in seinem Bericht „Klimaschutz in Österreich“ fest. Davon müsste der Bund voraussichtlich vier Fünftel stemmen, das andere Fünftel müssten die Länder berappen. Das sind unangenehme Nachrichten, die die Staatsspitze reizen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kanzelte den Bericht im ORF-Sommergespräch vergangene Woche „als „Weltuntergangsprognose des Rechnungshofs für das Jahr 2050“ ab und sagte: „Ich lasse mir nicht einreden, dass im Jahr 2050 wir irgendwelche Ziele nicht erreichen, daran glaube ich nicht.“
Worauf haben sich ÖVP und Grüne bereits verständigt?
Im türkis-grünen Koalitionsabkommen heißt es unter der Überschrift „ökosoziale Steuerreform“ auf Seite 78, die Regierung lege „ein besonderes Augenmerk auf die soziale Verträglichkeit, berücksichtigt regionale Unterschiede und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Österreich“. Kleinere Steuer-Anpassungen hat Türkis-Grün bereits vorgenommen, unter anderem wurde die Normverbrauchsabgabe reformiert, die bei der Erstzulassung eines Autos fällig wird und die Flugticketabgabe erhöht. Der große Wurf ist mit der ökosozialen Steuerreform im Koalitionsabkommen für 2022 festgeschrieben -und der Zeitplan soll trotz Corona halten.
Die ökosoziale Steuerreform soll laut Koalitionsprogramm CO₂ einen Preis geben, aber aufkommensneutral sein. Übersetzt heißt das: keine zusätzliche Belastung bringen. Teil der Verhandlungsmasse ist vor allem die Umsetzung. Hier gibt es zwei große Linien. Einerseits die CO₂-Steuer, die die Grünen wollen. Andererseits ein nationales Emissionshandelssystem, das die ÖVP bevorzugt.
Wie sieht das Modell der Grünen aus?
„Unser Modell einer aufkommensneutralen ökologisch-sozialen Steuerreform wurde vor über 23 Jahren von Alexander Van der Bellen und Monika Langthaler präsentiert und war für uns in Grundzügen der Startpunkt für die Verhandlungen“, sagt der grüne Klimasprecher Lukas Hammer. Das Modell sieht eine Umverteilung von oben nach unten vor. Wer sich klimafreundlicher verhält, profitiert, wer sich klimaschädlich verhält, zahlt mehr. Der langjährige grüne Budgetsprecher Bruno Rossmann hat dieses Modell maßgeblich mitgestaltet. 2017 wechselte er zur Liste Pilz und hat das Konzept im Jahr 2019 aktualisiert und verfeinert. „Ein wesentlicher Punkt war, dass die Einnahmen aus der CO₂-Steuer von privaten Haushalten und Unternehmen an diese wieder zurückfließen“, erklärt Rossmann. Konkret würde der Staat jedem Österreicher pro Kopf denselben Betrag überweisen und zugleich entsprechend die lohnsummenbezogenen Abgaben der Unternehmen senken.
Für Härtefälle gibt es in diesem Modell einen eigenen Topf, um sie beim Umstieg zu unterstützen -etwa für Pensionisten, die noch mit Öl heizen und sich alleine den Umstieg nicht leisten können, oder für Pendler, die aufs Auto angewiesen sind. Rossmann ließ sein Modell 2019 vom Budgetdienst des Parlaments durchrechnen. „Es sind die niedrigeren Einkommen, die mit dem Modell deutlich stärker entlastet werden, das zeigt sich ziemlich deutlich“, sagt Rossmann. Auch Volkswirt Steininger meint: Wenn jeder Bürger denselben Betrag aus der CO₂-Bepreisung vom Staat überwiesen bekommt, werden die Niedrigverdiener entlastet.
Woran knüpft die ÖVP bei der CO₂-Bepreisung an?
An den 25. November 1989. Damals stellte der ÖVP-Chef Josef Riegler auf dem Zukunftskongress der Partei die Ökosoziale Marktwirtschaft vor. Das Konzept sah vor, die Umwelt zu schützen, „indem durch ökologische Kostenwahrheit, Verursacherprinzip und eine ökosoziale Steuerreform auf dem Markt die richtigen Signale für eine nachhaltige Entwicklung gegeben werden“, erklärt Riegler. Er gilt als lauteste Stimme für eine CO₂-Bepreisung und sagte bei einer Veranstaltung des Ökosozialen Forums Ende Juni über den CO₂-Preis: „Es ist keine Frage mehr ob, sondern wie.“
Die ÖVP stützt sich auf Rieglers politisches Vermächtnis und betont, dass die ökosoziale Marktwirtschaft ein altes ÖVP-Konzept ist. Sie bevorzugt in dessen Umsetzung allerdings keine CO₂-Steuer, sondern das marktwirtschaftliche Modell des sogenannten Zertifikatehandels. Wie das funktioniert, zeigt die EU vor, die 2005 ein Emissionshandelssystem einführte und damit den weltweit größten Markt für CO₂ schuf. Dieser umfasst rund 10.000 Anlagen im Stromsektor, in der verarbeitenden Industrie sowie Luftfahrtunternehmen. Mit den großen Verschmutzern deckt dieser Handel rund 40 Prozent der klimaschädlichen Gase in der EU ab.
Das System funktioniert so: Die EU schreibt vor, wieviel CO₂ in die Luft geblasen werden darf. Die Unternehmen bekommen dafür entsprechend viele Zertifikate, deren Zahl aber begrenzt ist. Erzeugt jemand weniger CO₂, kann er diese verkaufen. Erzeugt jemand mehr CO₂, muss er Zertifikate zukaufen. Auf EU-Ebene hat das System über viele Jahre nicht funktioniert, weil die EU zu viele Zertifikate in Umlauf brachte. In der jüngsten Vergangenheit stieg der Preis für Zertifikate allerdings rasant an und entfaltet nun seine Wirkung. Da die EU ab 2026 den Zertifikatehandel auch auf die Bereiche Gebäude und Verkehr ausweiten will, wäre das türkise Modell leichter kompatibel, argumentiert die ÖVP.
Was liegt noch auf dem Verhandlungstisch?
Neben der Art der Umsetzung – also CO₂-Steuer oder Zertifikatehandel -verhandeln die Koalitionspartner, welche Bereiche von der CO₂-Bepreisung umfasst sein sollen, wie hoch der CO₂-Preis sein soll und wie stark er in den kommenden Jahren ansteigen soll. Auf der anderen Seite feilscht Türkis-Grün auch darum, wer wie viel aus den Einnahmen zurückbekommt.
„Parallel dazu ist eine zusätzliche breite Entlastung das Ziel“, heißt es aus dem türkisen Finanzministerium. Im Gespräch ist etwa eine Senkung der Lohnsteuer sowie der Körperschaftsteuer, die Unternehmen zugutekommen soll. Laut Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) soll nicht nur jenen mehr bleiben, die umweltschonend leben, sondern auch dem „arbeitenden Mittelstand“.
Wie haben es andere Länder gemacht?
Seit 1991 besteuert Schweden CO₂. Die Steuer wurde über die Jahre schrittweise erhöht, die Tonne CO₂ kostete anfangs 24 Euro und liegt heute bei 114 Euro. Nirgendwo zahlt man mehr fürs klimaschädliche Gas. Dabei war die steuerliche Veränderung für die Bevölkerung zunächst kaum spürbar: Im Gegenzug zur CO₂-Besteuerung wurden nämlich die Lohnsteuer gesenkt und andere unbeliebte Steuern wie die Erbschafts-und Vermögensabgabe gestrichen. Zusätzlich wurden mit den Einnahmen aus den Steuern soziale Projekte unterstützt.
Seit 2008 besteuert auch die Schweiz fossile Brennstoffe, in erster Linie Erdgas und Heizöl. Zwei Drittel dieser Steuereinnahmen werden verbrauchsunabhängig und pro Kopf an die Bevölkerung und die Wirtschaft rückerstattet. Die Gelder des letzten Drittels werden in einen Klimafonds investiert. Die Regierung fördert damit unter anderem den Ausbau des Gebäudebaus, des Fernwärmenetzes und der Ladestationen für Elektroautos.
Als warnendes Beispiel gilt hingegen Frankreich. Dort führte Präsident Emmanuel Macron eine Treibstoffsteuer ein, ohne die Einnahmen sozial umzuverteilen. Er erntete damit den Protest der Gelbwestenbewegung, die ihn politisch stark unter Druck brachte.
Für Türkis-Grün dürfte der Weg der deutschen Regierung am spannendsten sein. Sie gibt seit Anfang des Jahres CO₂-Emissionen durch fossile Brennstoffe einen Preis, und zwar in einer Art Mischform aus CO₂-Preis und Zertifikatehandel. Unternehmen, die fossile Energieträger verkaufen, müssen Zertifikate erwerben. Die zusätzlichen Kosten geben sie über den Preis an die Verbraucher weiter. Jährlich wird die Menge der angebotenen Zertifikate gesenkt. Eigentlich bestimmen Angebot und Nachfrage den Preis der fossilen Brennstoffe. Damit sich die Bevölkerung besser auf die Einführung einstellen kann, wird zunächst für die nächsten Jahre ein Fixpreis festgelegt: Für heuer beträgt der Preis pro CO₂-Tonne 25 Euro, bis 2025 soll er auf 55 pro Tonne ansteigen. Der Zertifikatehandel funktioniert also in der Anfangsphase ähnlich einer CO₂-Steuer.
Wie hoch soll der CO₂-Preis sein?
Die Frage ist so komplex, dass der österreichische Klimaökonom Gernot Wagner ein ganzes Buch darüber schrieb („Klimaschock“). Das Schwierige daran, einen Preis festzulegen: Wir wissen nicht, wie sich die Klimakrise auswirkt. Sie kann Kipppunkte auslösen, die zu einer Katastrophe führen könnten, die sich mit Geld kaum bewerten lässt. Zum Beispiel, wenn der Amazonas austrocknet oder der Golfstrom zum Erliegen kommt. „Es sind genau diese Ereignisse mit vielleicht niedrigen Wahrscheinlichkeiten, aber extrem großen Konsequenzen, die zum Klimaschock führen können. Ob dann der CO₂-Preis 100,200 oder 400 Euro sein sollte, wenn man diese Risiken und Ungewissheiten tatsächlich mit einbezieht, weiß niemand“, erklärt Wagner.
Der Internationale Währungsfonds empfahl Österreich heuer, 25 Euro pro Tonne CO₂ festzulegen. Diese Zahl hat auch Finanzminister Blümel als Startpreis ins Spiel gebracht. Das würde den Liter Benzin um 6 Cent, einen Liter Diesel um 6,9 Cent und einen Liter Heizöl um 7,1 Cent erhöhen, rechnet Wifo-Ökonomin Köppl vor: „Das ist im Vergleich zu den Schwankungen beim Preis an den Tankstellen kaum spürbar. Eine Richtschnur und Größenordnung könnte der aktuelle Zertifikatepreis in der EU sein.“ Dieser liegt derzeit bei 62 Euro pro Tonne CO₂.
Klar ist, dass der CO₂-Preis Schritt für Schritt steigen muss. Sonst verfehlt die türkis-grüne Politik ihr Ziel, Österreich bis 2040 klimaneutral zu machen. Wie hoch der Preis werden könnte, hat das Internationale Institut für angewandte Systemanalyse (IIASA) im niederösterreichischen Laxenburg vor wenigen Tagen berechnet. Die Ökonomen gehen davon aus, dass die Klimakrise bis zu sechs Mal teurer werden könnte als bislang angenommen. Das weltweite Bruttosozialprodukt könnte Ende des Jahrhunderts infolge von Klimaschäden um 37 Prozent einbrechen. Demnach wäre die Tonne CO₂ rund 2.500 Euro wert.
Falter