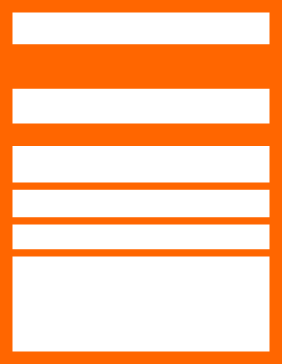Österreichs ehrgeizige Klimaziele können nur mit Milliardeninvestitionen erreicht werden. Doch für die notwendigen Projekte müssten die Genehmigungsverfahren und vor allem die Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) deutlich beschleunigt werden.
Hundert Prozent Strom aus erneuerbarer Energie bis 2030, Klimaneutralität bis 2040: Die Regierung hat sich ehrgeizige Klimaschutzziele gesetzt. Eine Herkulesaufgabe, wenn man bedenkt, dass aktuell noch zwei Drittel des Energiebedarfs von fossilen Energieträgern abgedeckt werden.
Bereits jetzt steht fest: Wir können die Ziele nicht zeitgerecht erreichen. Dazu fehlen die Projekte und dafür dauern die Genehmigungsverfahren viel zu lange, denn fast alle für die Energiewende erforderlichen Projekte bedürfen auch einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). Und diese Verfahren dauern zu lang.
Die 380-kV-Salzburgleitung und Speicherkraftwerksprojekte mit Verfahrensdauern von sieben bis zehn Jahren sind nur die Spitze des Eisbergs, auch Windkraftverfahren dauern mittlerweile bis zu vier Jahre. Ohne deutliche Beschleunigung der Genehmigungsverfahren sind die Klimaschutzziele reine Makulatur. Dabei gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die Qualität und das Tempo der Verfahren deutlich zu erhöhen:
Wenn man – wie derzeit – im Genehmigungsverfahren jederzeit Neues vorbringen kann, so lädt dies geradezu zu missbräuchlicher Verfahrensverzögerung ein. Inhaltliche Vorbringen aus taktischen Gründen zurückzuhalten und erst unmittelbar vor Schluss des Verfahrens einzubringen und neue Sachverständige zu beantragen, ist für manche Projektgegner Usus geworden. Das hilft weder Umwelt noch Klima, sondern dient nur der Verzögerung. Dieser grundlegende Mangel des Verfahrensrechts gehört behoben; der Gesetzgeber muss der Behörde Instrumente an die Hand geben, um das Verfahren sinnvoll zu gliedern.
Eine Möglichkeit: Die Einreichunterlagen werden öffentlich aufgelegt, dazu kann jedermann Stellung nehmen und Einwendungen erheben. Dann sollen die Behördensachverständigen ihre Gutachten ungestört erstatten. Dazu können alle Verfahrensparteien binnen einer angemessen festzusetzenden Frist Stellung nehmen. Sodann findet eine mündliche Verhandlung statt, in der noch offene Fragen erörtert werden.
Gegen den Bescheid kann Beschwerde erhoben werden; ein späteres Nachschieben weiterer Beschwerdegründe ist unzulässig; ebenso, außerhalb der festgesetzten Fristen ein Vorbringen zu erstatten. Ein solch klar strukturiertes Verfahren würde zu einer enormen Beschleunigung führen, ohne an Qualität einzubüßen.
Weitere Verbesserungen, etwa die Beseitigung der anachronistischen „Ediktalsperre“, die Digitalisierung der Verfahren oder die Ergänzung der Verfahrensförderungspflicht um eine angemessene Kostentragung bei Verstößen, sollten folgen. Dass der Stand der Technik im Verfahren bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung nachgezogen werden muss, was bei umfangreichen Verfahren zu großen Verzögerungen führt, könnte ebenfalls leicht behoben werden – etwa indem auf den Zeitpunkt der Antragstellung abgestellt wird.
Inhaltliche Vorgaben erfordert
Eines ist klar: Jedes auch noch so „grüne“ Projekt hat auch nachteilige Umweltauswirkungen. Windräder beeinträchtigen das Landschaftsbild und gefährden Vögel; Wasserkraftwerke beeinträchtigen die Gewässerökologie. Man muss sich also letztlich entscheiden, welche Interessen höher wiegen: jene an der Projektumsetzung oder am Umweltschutz.
Um inhaltliche Vorgaben und Entscheidungen kommt man nicht umhin. In einem demokratischen Rechtsstaat sollten die Vorgaben so weit als möglich vom Gesetzgeber kommen. Mit klaren und vorhersehbaren Festlegungen lassen sich Investitionen in die richtige Richtung lenken. Unklare Regelungen – wie eine kaum prognostizierbare Interessenabwägung ganz am Ende eines aufwendigen Verfahrens – bewirken das Gegenteil.
Langfassung auf derStandard.at/Recht
Christian Schmelz ist Partner bei Schönherr Rechtsanwälte und unter anderem Experte für öffentliches Recht und Umweltrecht.
Der Standard