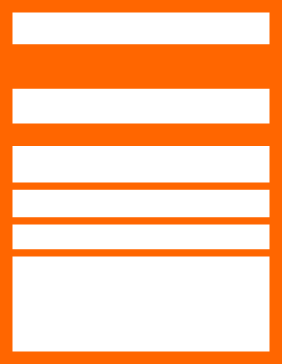Energiekrise. Die EU ist hilflos. Ihre Wette, sich durch Flüssiggas vom Kreml unabhängig zu machen, wurde zum Bumerang. Ihre Chefs sind uneinig und verheddern sich in Details.
Während im Osten Europas die ersten Frostnächte den nahenden Winter verkünden, strauchelt die Europäische Union in die schwerste energiepolitische Krise seit den 1970er-Jahren. Das globale Zusammenspiel von pandemiebedingten Logistikpannen und dem enormen Appetit auf Flüssiggas in Asien und den USA sorgt für einen überwältigenden Anstieg der Gas- und, weil aneinandergekoppelt, Strompreise. Die Union ist jedoch nicht darauf vorbereitet, auf diese weltweiten Phänomene wirksam und rasch reagieren zu können. Es gibt zu wenig Gas, und der Einzige, der spontan fast beliebig viel liefern könnte, ist der russische Präsident, Wladimir Putin, der dafür allerlei politische Opfer fordert: von den westlichen Ambitionen der Ukraine und der Republik Moldau bis zur Inbetriebnahme seiner neuen Gaspipeline Nord Stream 2 – die genau diese Abhängigkeit der Europäer vom Kreml auf Jahrzehnte zu verfestigen droht.
Wie konnten die Europäer, die in jüngerer Vergangenheit immer öfter und lauter von „Weltpolitikfähigkeit“ und „strategischer Autonomie“ redeten, in so eine Zwangslage geraten? Vier hausgemachte Effekte greifen hier ineinander.
Energiepolitischer Flickenteppich
Erstens ist Energiepolitik großteils eine Domäne der Nationalstaaten. Der Vertrag über die Arbeitsweise der EU hält fest, dass in dieser Frage „geteilte Zuständigkeit“ zwischen EU und Mitgliedstaaten gilt. Artikel 170 sieht bloß vor, dass die EU zum Ausbau transnationaler Netze beiträgt. Doch für Entscheidungen zu „Maßnahmen, welche die Wahl eines Mitgliedstaats zwischen verschiedenen Energiequellen und die allgemeine Struktur seiner Energieversorgung erheblich berühren“, braucht es die Einstimmigkeit aller 27. Die „Energiepolitik“ der EU „erfolgt im Geiste der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten im Rahmen der Verwirklichung oder des Funktionierens des Binnenmarkts.“
In Normalzeiten ist das vernünftig. Zu unterschiedlich sind Topografie, industrielle Struktur, politische Tradition und gesellschaftliche Vorlieben in den Mitgliedstaaten. Die EU soll nur gewährleisten, dass diese nationalen Märkte einander nicht in die Quere kommen und dass die Elektronen hurtig von einem Ende Europas an das andere geleitet werden können.
In Krisenzeiten aber – und das ist der zweite hausgemachte Grund für die aktueller Malaise – sorgt diese politisch gewollte Kleinstaaterei dafür, dass die Union keine ist, sondern sich einfach spalten lässt. Divide et impera: Wenn Putin, wie am Mittwoch geschehen, Österreich und Deutschland zusichert, mehr Gas zu liefern, tut er das nicht aus Humanismus oder in Erfüllung der Vertragspflichten seines Machtvehikels Gazprom. Er zeigt der EU damit die Grenzen ihrer Weltmachtfantasien auf.
Drittens saßen die Europäer einer fatalen Fehleinschätzung auf. Sie begannen vor einigen Jahren, nach und nach aus langfristigen Lieferverträgen für Gas auszusteigen. Der Gasmarkt sollte dem für Öl ähnlicher werden, der Preis für den Kubikmeter Gas sich also an den Spotmärkten bilden. Die Idee dahinter war einleuchtend. Je weniger der Gaspreis von ein paar Lieferanten abhängig ist, desto resilienter ist der Markt. Eine Zeit lang funktionierte das. 2019 und 2020 sanken die Energiepreise in Europa. Doch nun zeigt sich, dass auf Flüssiggas kein Verlass ist, wenn es hart auf hart geht. All das ließe sich natürlich reparieren. Doch viertens blockieren sich die EU-Spitzen selbst. Die 27 Staats- und Regierungschefs ziehen seit Jahren mehr und mehr Themen an sich, statt ihre detaillierten technischen Fragen von den Fachministern vorab lösen zu lassen. Doch bei ihren EU-Gipfeln sitzen die 27 Chefs allein im Saal, ohne Experten und Fachbeamte. So etwas kann nicht klappen: Kein Wunder, dass bei dem Gipfel vorige Woche in keinem der Punkte – Energie, Migration, Rechtsstaat – etwas beschlossen worden ist. Eine Woche vor Weihnachten wollen sie es erneut versuchen. Bis dahin gilt die Hoffnung auf einen milden Winter.
von unserem Korrespondenten Oliver Grimm
Die Presse