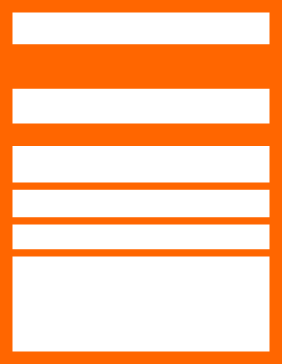Die Strombranche geht wegen steigender Systemkosten auch auf längere Sicht von höheren Preisen aus – obwohl der Anteil der erneuerbaren Energie steigt. Der Sektor ruft zudem laut nach einem Stromgesetz.
Es braut sich etwas zusammen, und man weiß nicht genau, woran es liegt: Händler, die jetzt an der Börse elektrische Energie schon für das kommende Jahr einkaufen, zahlen um einiges mehr, als dies noch vor ein paar Monaten der Fall war. Im Fachjargon heißt das, dass die Preise am Terminmarkt steigen.
Dieser Trend zeichne sich seit Ende Februar ab, sagte Michael Strugl, Verbund-Chef und Präsident von Österreichs Energie, am Mittwoch bei der Präsentation eines „Zukunftspakets für Österreich“. Von etwas über 70 Euro je Megawattstunde (MWh) seien die Großhandelspreise für Strom zur Auslieferung 2025 kontinuierlich auf etwa 90 bis 95 Euro je MWh gestiegen – eine Bandbreite, in der die Preise derzeit schwankten.
Woran das liegt? „Diese Frage haben wir uns selbst gestellt“, sagte Strugl. An und für sich spreche einiges dafür, dass die Preise nach unten gehen sollten. Die Konjunktur sei schwach, die Stromnachfrage entsprechend gedämpft.
Andererseits habe es zuletzt einen starken Zubau an neuer Erzeugungskapazität gegeben, insbesondere bei Photovoltaik und im europäischen Maßstab auch bei Wind. Wenn mehr Angebot am Markt ist und die Nachfrage eher mau, sollten die Preise gemäß den Marktmechanismen eher sinken.
Zwei mögliche Treiber
„Wir sehen im Wesentlichen zwei mögliche Treiber“, sagte Strugl. „Das eine ist der CO₂-Preis, der gestiegen ist; das andere, dass der Markt möglicherweise ein Ansteigen der Gaspreise nach Auslaufen des Gastransitvertrags zwischen Russland und der Ukraine Ende des Jahres antizipiert.“ Weil Strom auch in Gaskraftwerken erzeugt wird und diese gemäß Merit-Order als zuletzt zugeschaltete Stromerzeugungsanlagen immer wieder den Preis der gesamten Strommenge zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmen, könnte sich dieses Phänomen in den Future-Kontrakten jetzt schon niederschlagen. Genaueres aber wisse man nicht.
Dass der Strombezug aber jemals wieder so günstig wird, wie dies vor Corona und vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine der Fall war, sei unrealistisch. Damals kostete Strom im Großhandel 20 Euro je MWh, teilweise sogar weniger – und die Netztarife, die zusätzlich zum verbrauchten Strom ins Gewicht fallen, waren um einiges niedriger, als sie es jetzt sind.
Es liege vor allem an den Kosten für das Netz, die deutlich steigen werden, weil Leitungen mit Milliardenaufwand ausgebaut werden müssen, um den Erfordernissen dezentraler Energieproduktion mit Windkraft und Photovoltaik (PV) Rechnung zu tragen.„Der Satz, die Sonne schickt keine Rechnung, stimmt so nicht“, sagte Barbara Schmidt, Generalsekretärin von Österreichs Energie. „Die Kosten für das System insgesamt steigen, weil PV- und Windkraftanlagen integriert werden und Reservekraftwerke bereitstehen müssen, wenn einmal kein Wind weht und keine Sonne scheint.“ Denn auch im Fall einer Dunkelflaute muss das System ausbalanciert werden.
Notwendige Gesetze
Herausforderungen jedenfalls gebe es genug, betonten Strugl wie Schmidt. Mit einem „Zukunftspakt für Österreich“, das über alle Parteigrenzen hinweg außer Streit gestellt werden sollte, ließen sich diese bewältigen. Dazu gehöre ein klares Bekenntnis zur Transformation des Energiesystems von fossil auf erneuerbar mit allem, was daran hängt, wie zusätzlichen Leitungen, Speichern und Erzeugungsanlagen. Dazu gehöre auch, dass die Politik liefert – etwa das Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG), das Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) einmal als „Betriebssystem für die Energieversorgung der Zukunft“ bezeichnet hat; dieses ist zwar weit gediehen, hat es bisher aber nicht ins Parlament geschafft. Oder auch das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz, „wo wir noch gar keinen Entwurf gesehen haben“, wie Strugl betonte.
Und noch einen dringenden Wunsch formulierte der Präsident von Österreichs Energie, an die künftige Bundesregierung gerichtet: Man möge doch, wenn es um Energie-, Standort- und Infrastrukturfragen geht, die derzeit zersplitterten Kompetenzen so gut wie möglich in einem Ministerium bündeln. Dann käme man sicher schneller und effizienter voran.
Der Standard