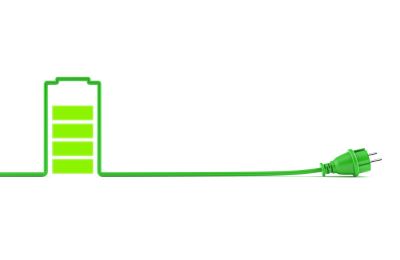
Raumkühlung. Als ökologischere Variante zur Klimaanlage rückt die Fernkälte in den Fokus von immer mehr Betrieben, öffentlichen Gebäuden und Städten. Was verspricht die Lösung und wie praktikabel ist die Umsetzung?
Der Kühlbedarf in Österreichs Gebäuden steigt rasant: Um 28 Prozent, so errechnete der FGW (Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen), stieg er von 2023 auf 2024. Kein Wunder: 2024 war in Österreich das mit Abstand wärmste Jahr der Messgeschichte. Im Tiefland und auf den Bergen war es im Mittel um 1,8 Grad wärmer als in einem durchschnittlichen Jahr in der ohnehin warmen Klimaperiode 1991 bis 2020. Gemessen wird der Kühlbedarf übrigens an den Kühlgradstunden, die sich aus der Summe der stündlichen Differenzen zwischen der gewünschten Raumtemperatur (Kühlgrenze) und der Außentemperatur während der gesamten Kühlperiode errechnen.
Mehr Kühlen als Heizen
Aber nicht nur Hitzetage und Tropennächte lassen die Nachfrage steigen. „Serverräume oder manche Bereiche in Krankenhäusern brauchen ganzjährig konstante Temperaturen“, sagt Burkard Hölzl, Fernkälte-Experte bei Wien Energie. „Es ist davon auszugehen, dass wir in 20 Jahren gleich viel Energie für das Kühlen wie für das Heizen brauchen“, ergänzt Katalin Andrea Griessmair-Farkas, stellvertretende Geschäftsführerin der FGW. Hierzulande sei weniger als die Hälfte der Büros klimatisiert, in Zukunft könnten es aber 80 Prozent sein.
Dementsprechend rückt das Thema Fernkälte immer mehr in den Fokus, gilt sie doch als ökologisch verträglicher und effizienter als die Kühlung mittels herkömmlicher Klimaanlagen. „Gegenüber diesen spart Fernkälte rund 70 Prozent Energie und 50 Prozent CO2. Außerdem trägt sie dazu bei, Stromspitzen im Sommer abzufedern“, erklärt Griessmair-Farkas. Konkret wird zur Erzeugung von Fernkälte mittels „Absorptionskältemaschinen“ meist Abwärme aus der Industrie, von Kraft-Wärme-Koppelungsanlagen (KWK) oder der Abfallverbrennung genützt, die das ganze Jahr anfällt. Isolierte Rohre transportieren das auf fünf bis sechs Grad Celsius gekühlte Wasser zu den Kunden, wo die Kälte an das hauseigene Klimatisierungssystem abgegeben wird. Danach fließt es mit einer Temperatur von etwa 16 Grad Celsius zur neuerlichen Abkühlung zurück in die Kältezentrale.
Auch Energieversorger investieren österreichweit in den Bau von Fernkälteanlagen und den Ausbau des Netzes. Im Frühjahr will Wien Energie die neue Kältezentrale beim Med-Uni-Campus in Betrieb nehmen. „Dann haben wir 24 Kältestandorte in Betrieb, nämlich acht Fernkältezentralen mit Fernkältenetz und 16 dezentrale Kältelösungen direkt bei Kunden“, so Hölzl. Im Vorjahr, und damit ein Jahr früher als geplant, wurde der sogenannte Fernkältering unterhalb der Ringstraße geschlossen. Auch in den nächsten Jahren wird kräftig investiert: So soll beispielsweise die Kapazität der Fernkälte von derzeit 220 Megawatt auf rund 370 Megawatt steigen, auch das Netz wird weiter ausgebaut.
Netzausbau in Stadt und Land
Wien ist aber nicht die einzige Stadt, die auf die Kälte aus der Ferne setzt. „Linz und St. Pölten gehören ebenfalls zu den cool Spots“, so Griessmair-Farkas. Auch Graz, Klagenfurt und Bregenz setzen künftig auf nachhaltige Kälteversorgung. In der Vorarlberger Landeshauptstadt und anderen Gemeinden soll beispielsweise Bodenseewasser Gebäude klimaneutral heizen und kühlen. (siehe Kasten).
Wie auch schon bisher werden vor allem öffentliche und gewerbliche Gebäude in den Genuss von Fernkälte kommen. „Das liegt daran, dass für die Verwendung von Fernkälte ein zentrales Kälteverteilsystem erforderlich ist. Bei Wohnhäusern im Bestand ist das meist nicht vorhanden“, weiß Hölzl. Diese Systeme nachträglich einzubauen, sei außer bei Kernsanierungen kaum möglich. Zum einen sei es oft schwer, alle Eigentümer für das Projekt zu gewinnen – angesichts der relativ hohen Investitionen. Zum anderen seien die dafür erforderlichen Arbeiten den Bewohnern kaum zuzumuten. „Wenn, dann kann man die Systeme im Zuge von Generalsanierungen einbauen.“ Bei Wohnungen in Quartierslösungen seien auch andere nachhaltige Varianten zur Temperierung von Gebäuden abseits der Fernkälte möglich.
Wie etwa beim Village im Dritten: Für die Heizung und Kühlung des neuen Stadtquartiers mit rund 2000 Wohnungen, 39.000 Quadratmetern Büro- und Gewerbeflächen sowie einer Schule und zwei Kindergärten werden insgesamt 500 Erdsonden gebohrt, die bis in 150 Meter Tiefe reichen. Damit wird im Winter Wärmeenergie aus dem Boden gewonnen und im Sommer eingespeichert – ein ebenfalls nachhaltiger Weg zur Temperierung.
von Ursula Rischanek
Die Presse








