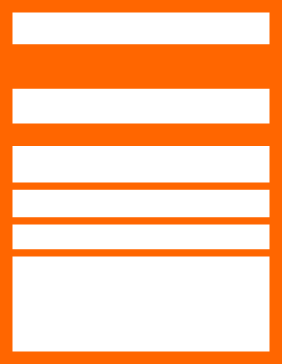COP29. Knapp 200 Staaten fixieren Regeln für den Handel mit Klimaschutzzertifikaten. Das soll Milliarden für die grüne Wende bringen, aber die Kritik ist groß.
Wir lernen: Je kritischer die Welt auf den Gastgeber einer Klimakonferenz blickt, desto rascher liefern die Austragungsländer schlagzeilentaugliche Resultate. So hatte auch Muchtar Babajew, Präsident der 29. Klimakonferenz (COP29) in Aserbaidschan, schon am ersten Tag der Verhandlungen einen echten „Durchbruch“ im Gepäck: Neun Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen konnten sich die Staaten endlich auf grundlegende Regeln für den grenzüberschreitenden Handel mit CO₂-Zertifikaten einigen. Das soll helfen, Billionen an Dollar zu mobilisieren, die für Klimaschutz und Anpassung an steigende Temperaturen weltweit benötigt werden. Doch nicht alle Beobachter sind begeistert über den Vorstoß. „Die Presse“ beantwortet die wichtigsten Fragen zum Deal.
1 Was sind CO2-Märkte und warum sind sie wichtig?
Die Idee hinter diesen CO₂-Märkten ist simpel: Unternehmen oder Staaten setzen Klimaschutzprojekte in einem gewissen Land um – etwa die Aufforstung von Wäldern oder den Bau von Ökostromkraftwerken – und können die dadurch erzielte Reduktion an Treibhausgasemissionen an andere Unternehmen oder Staaten weiterverkaufen. Haben große Emittenten wie China oder die USA etwa Probleme, ihre Klimaziele im eigenen Land zu erreichen, können sie das künftig auch durch die Finanzierung von entsprechenden Projekten in anderen Staaten ausgleichen. Gleichzeitig soll dieses System garantieren, dass auch ärmere Staaten genug Kapital für Klimaschutzprojekte erhalten. Die hundert Milliarden Dollar an öffentlichen Mitteln, die die Industrienationen derzeit pro Jahr an Entwicklungsländer abliefern, reichen dafür bei Weitem nicht aus.
2 Warum gibt es das nicht schon lang?
Bestehende Emissionshandelssysteme funktionieren meist so, dass Unternehmen für jede Tonne an CO₂, die sie ausstoßen, bezahlen müssen. Klimaschutzzertifikate bieten hingegen nur private Anbieter an, für die Klimaziele der einzelnen Staaten gelten diese Papiere aber nicht. Der Handel auf den freiwilligen Märkten ist unreguliert, die Qualität der Projekte variiert so stark wie die Preise für eine Tonne CO₂-Reduktion. Einheitliche Regeln sollen das ändern und den Aufbau eines glaubwürdigen CO₂-Marktes ermöglichen, lautete daher seit 2015 der Auftrag an die Staaten. Alle bisherigen Versuche, einen derartigen „Gold Standard“ zu schaffen, sind gescheitert, weil die EU die Sorge hatte, dass die Regeln den Missbrauch des Systems nicht verhindern würden.
3 Sind neue Skandale jetzt ausgeschlossen?
Der Handel mit Klimaschutzzertifikaten hat eine durchwachsene Historie: 1997 implementierten die Staaten unter dem Kyoto-Protokoll den ersten offiziellen Kohlenstoffmarkt. Doch eine Reihe an Skandalen ließ das System kollabieren. Die nun vereinbarten Regeln bringen Verbesserungen: So soll klarer werden, welche Projekte wirklich zusätzlich Emissionen vermindern, und die Entwicklung der Technik (etwa in Form von Überwachung durch Satelliten) erleichtert auch die Kontrolle, ob aufgeforstete Wälder das CO₂ auch so lang binden wie versprochen. Doch es gibt etliche offene Punkte, die Regeln sollen weiter nachgeschärft werden, hieß es. Umweltschützer kritisieren den Deal daher als „Schnellschuss“, der Klima und Menschenrechte nicht schütze.
4 Ist der Deal aus Baku ein echter Durchbruch?
Die Einigung ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die International Emissions Trading Association schätzt, dass der nun skizzierte Markt jedes Jahr 250 Milliarden an US-Dollar generieren und den Treibhausgasausstoß um fünf Milliarden Tonnen reduzieren könnte. Doch der Kompromiss hat einen fahlen Beigeschmack. Allein schon aufgrund der Art und Weise, wie er zustande gekommen ist. Die Regeln wurden nämlich nicht von allen Staaten im Plenum ausgehandelt, sondern vorab von einer Expertengruppe (dem Supervisory Body) festgezurrt. Anders als üblich hatten die Staaten diesmal keine Chance mehr, noch am Text zu rütteln. Dieser „Hinterzimmer-Deal“ am ersten Tag lasse für die weiteren Verhandlungen nichts Gutes erwarten, sagen Beobachter.
von Matthias Auer
Die Presse