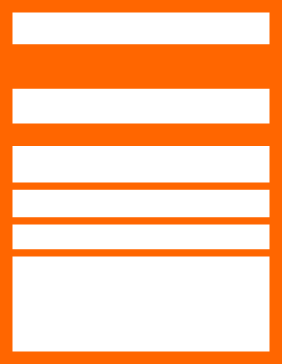Laut Berechnung des Vergleichsportals Durchblicker.at könnten die Stromkosten für Privathaushalte um 725 Euro pro Jahr steigen, Energiekonzerne cashen zugleich ab. Könnte man sie zur Kasse bitten?
Der Blick auf die Stromrechnung im kommenden Jahr wird bei Österreichs Haushalten für wenig Freude sorgen. Im Jänner laufen nicht nur staatliche Energiehilfen aus, es steigen auch die Gebühren für den Ausbau der Stromnetze. Die Vergleichsplattform Durchblicker warnt nun vor Mehrkosten von bis zu 725 Euro für einen durchschnittlichen Familienhaushalt. Das entspricht einem Anstieg von 45 Prozent.
Was steckt dahinter? Allein die auslaufende Stromkostenbremse lässt laut Durchblicker-Berechnungen die Kosten für einen drei- bis vierköpfigen Haushalt um 435 Euro im Jahr steigen. Konkret ist das aber stark vom jeweiligen Stromtarif abhängig. Ursprünglich hatte die Preisbremse den Haushalten für die ersten 2900 Kilowattstunden (kWh) bis zu 30 Cent pro kWh erspart, nun wird diese Hilfe komplett wegfallen. Zudem werden mit 2025 auch Elektrizitätsabgabe und Erneuerbare-Förderkosten steigen. Diese waren temporär ausgesetzt bzw. gesenkt worden und dürften bald wieder auf ihr ursprüngliches Niveau zurückkehren. Laut Durchblicker-Berechnung bedeutet das Mehrkosten von 56 bzw. 118 Euro pro durchschnittlichem Familienhaushalt.
Netzausbau treibt Kosten
Dazu kommen die steigenden Netzentgelte. Deren Erhöhung legt die Regulierungsbehörde E-Control jährlich auf Basis eines komplizierten Schlüssels fest. Bei Strom erhöhen sich diese Gebühren im Schnitt um 23,1 Prozent, bei Gas um 16,6 Prozent. Die Kostensteigerungen variieren je nach Bundesland und dortigem Netzausbaubedarf zwischen acht Prozent in Tirol und knapp einem Drittel in Niederösterreich. Jedenfalls: Die Energierechnungen werden dadurch nochmals um einiges höher werden.
Aber warum steigen die Netzgebühren ausgerechnet für Haushalte so stark? Waren es nicht die Energiekonzerne, die mit Milliardenprofiten in die Schlagzeilen gerieten? Könnten die Netzausbaukosten nicht von ihnen geschultert werden statt von den Stromkunden? Laut Auswertung des gewerkschaftsnahen Momentum-Instituts haben die neun Landesenergieversorger 2023 rund 2,5 Milliarden Euro an Profiten eingefahren. Ein Zuwachs von 1,45 Milliarden Euro im Vergleich zum Schnitt von 2018 bis 2021. In der Rechnung nicht inbegriffen sind hier Konzerne wie der Verbund. Beim Wasserkrafterzeuger freute man sich im Vorjahr über einen Rekordgewinn von 2,6 Mrd. Euro.
Johannes Mayer, Chefökonom der E-Control, hält davon wenig. „Ein Großteil der Gewinne vieler Energiekonzerne stammt aus dem Produktionsbereich und damit den Großhandelspreisen, nicht unbedingt aus dem Endkundengeschäft.“ Das Argument dahinter: Die Konzerne lukrieren ihre großen Profite ja vornehmlich nicht direkt mit dem Endkundengeschäft, sondern mit der Stromerzeugung. Demnach sei es ein Stück weit ungerechtfertigt, die Kosten für den Netzausbau auf sie abzuwälzen. Außerdem verweist Mayer darauf, dass ein derartiges Vorhaben EU-rechtlich schwierig sein könnte.
Joel Tölgyes von der Arbeiterkammer Wien hingegen kann einer stärkeren Beteiligung von Energieerzeugern und -händlern durchaus etwas abgewinnen. Laut dem Energieexperten würden 94 Prozent der Netzkosten von Verbrauchern, also Unternehmen und Haushalten, getragen. Die Erzeuger würden nur sechs Prozent schultern, obwohl sie ebenso auf das Stromnetz angewiesen seien.
Spielraum gebe es etwa bei den sogenannten spezifischen Kostenanteilen, die im Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz (ELWOG) geregelt sind. Dazu muss man wissen, dass sich die Netzkosten aus mehreren Bereichen zusammensetzen. Da wären etwa die Netznutzungsentgelte, die 80 Prozent der Netzkosten ausmachen und zur Gänze von Verbrauchern gezahlt werden – oder auch die Netzverlustentgelte, bei denen die großen Erzeuger die Hälfte entrichten. „Das könnte man ändern“, schlägt AK-Experte Tölgyes vor. Er plädiert für eine ausgeglichenere Aufteilung. Ein zweiter Punkt: die Kosten für den Netzanschluss neuer PV- und Windkraftanlagen. Auch bei ihnen zahlen alle Stromkunden mit. Eine Änderung würde die Projekte zwar ein Stück weit unattraktiver machen, aber Kostensteigerungen in Industrie und Haushalten abfedern.
So viel zu den Energieerzeugern. Aber was ist mit großen Industriebetrieben, die zwar ein Drittel des Stroms verbrauchen, aber nur 14 Prozent der Netzkosten beisteuern? Auch hier bremst Mayer von der E-Control ein. „Die Netztarifisierung erfolgt auf dem Kostenverursachungsprinzip.“ Der Hintergrund: Es gibt insgesamt sieben Netzebenen, von der Niedrigspannung bis zur Höchstspannung. Private Haushalte und kleine Gewerbebetriebe sind praktisch auf alle sieben Ebenen angewiesen, während große Industrieplayer oft nur drei oder weniger beanspruchen. Deshalb sollen die Großen auch nicht mehr zahlen müssen, argumentiert Mayer: „Es sind vor allem die kleinen vergrabenen Leitungen und Trafostationen, die große Kostenteile ausmachen“.
Eine Möglichkeit bleibt damit noch übrig: die Finanzierungskosten. Die hohen Zinsen für Eigen- und Fremdkapital haben die Kosten für den Netzausbau ansteigen lassen, die die Netzbetreiber stemmen müssen. Hier könnte der Staat einspringen, sagt AK-Energieexperte Tölgyes. Ähnlich wie bei der Asfinag wäre es möglich, günstige Konditionen über die Bundesfinanzierungsagentur zu ermöglichen und den Netzbetreibern somit billiges Geld zur Verfügung zu stellen. Dies würde auch den Staatshaushalt nicht zusätzlich belasten – denn die Kosten für den Ausbau tragen ja weiterhin die Kunden, nur die Aufwendungen für Zinsen sind niedriger.
Was gäbe es sonst für Möglichkeiten für die Stromkunden, dem bevorstehenden Kostensprung zu entkommen? Politisch ließen sich die staatlichen Energiehilfen für Haushalte verlängern. Die Parteienlandschaft zeigt sich hier jedoch gespalten. Die FPÖ spricht mit dem Auslaufen von einer „Kostenlawine“, schlägt zur Gegenfinanzierung Einsparungen bei Migrations- und Klimapolitik vor. Die Grünen haben der ÖVP eigenen Angaben zufolge vorgeschlagen, die bisherigen Ausnahmeregelungen zu verlängern. Der große Koalitionspartner wiederum verweist auf die gesunkenen Strompreise, die ein Auslaufen der Hilfen nahelegten. Die SPÖ zeigt sich gesprächsbereit, bleibt aber unspezifisch, die Neos sprechen sich für eine kritische Auseinandersetzung aus – mit der Tendenz, die Hilfen planmäßig auslaufen zu lassen. Letztlich geht es um enorme Summen auch für den angespannten Staatshaushalt. Allein die Stromkostenbremse ist mit einer Milliarde Euro jährlich veranschlagt, bei den anderen beiden Abgaben sind es jeweils einige Hundert Millionen.
Tarifwechsel
Auf individueller Ebene gibt es auch noch eine andere Möglichkeit zur Kostensenkung: einen Tarifwechsel. Mit ihm lassen sich die Netzkosten zwar nicht beeinflussen, wohl aber können mit günstigeren Stromtarifen einige Hundert Euro gespart werden. Bloß: Die Wechselwilligkeit der Menschen bleibt bescheiden. Dass nur wenige den Stromversorger tauschen, wird von Experten schon lange bemängelt. Gesprächsstoff liefert nun eine Umfrage der Vergleichsplattform Tarife.at vom November. Demnach plant – selbst in Anbetracht der Kostensteigerungen – nur eine von fünf Personen, den Tarif demnächst zu wechseln. Die Vergleichsplattform hat dafür die Kosten gängiger Stromtarife der marktdominanten Landesenergieversorger mit dem günstigsten Anbieter am Markt verglichen. Das Ergebnis: Ein Wiener Haushalt mit 3500 kWh Stromverbrauch kann sich 160 Euro jährlich sparen, ein vergleichbarer Haushalt in Oberösterreich bis zu 330 Euro.
Der Standard