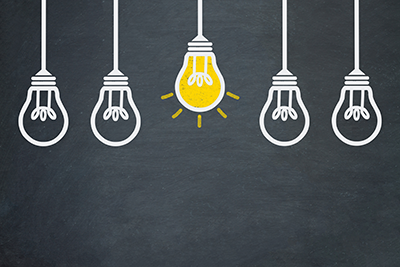Interview. Grüne Energie schützt die Umwelt, belastet aber das Stromnetz. Staatssekretärin Zehetner und Wien-Energie-Chef Strebl debattieren über Versorgungssicherheit.
Die Presse: Energiewende hieß bis vor Kurzem Kampf gegen den Klimawandel. Jetzt geht es um Versorgungssicherheit. Was ist damit gemeint?
Elisabeth Zehetner: Die Transformation unseres Energiesystems erfordert, dass wir andere Sicherheitsstandards anwenden. Es gibt immer weniger Kraftwerke, Gaskraftwerke etwa, die man auf Knopfdruck ein- und abschalten kann. Wir möchten diese Kraftwerke schließlich durch Erneuerbare ersetzen. Das wird uns zu einem hohen Anteil auch gelingen. Dennoch müssen wir uns darüber Gedanken machen, was braucht es, wenn eben kein Wind weht, keine Sonne scheint.
Aber dieser Knopfdruck muss ja nicht in einem fossilen Kraftwerk erfolgen. Es kann auch grüner Wasserstoff sein.
Michael Strebl: Genau. Ich bin dagegen, dass man fossile Kraftwerke neu baut. Wir sprechen von einem integrierten Energiesystem. Dazu gehören Umweltschutz, Leistbarkeit, aber auch Versorgungssicherheit. Und wir sollten nicht in die gleiche Falle wie Deutschland tappen.
Dort hat man Kraftwerke übereilt stillgelegt, die man nun dringend brauchen würde.
Strebl: Und diesen Fehler dürfen wir nicht auch machen. Wir brauchen Back-up-Systeme und es wird eine Zeit lang dauern, bis wir diese haben.
Zehetner: Deshalb müssen wir darüber diskutieren, welches System dafür am besten und günstigsten ist. Und nur, um hier ein Missverständnis auszuräumen: Viele glauben, man braucht diese Back-up-Kraftwerke, falls zu wenig Strom vorhanden ist. Nein, man braucht diese Eingriffe auch, wenn zu viel Strom im Netz ist. Das geschieht gerade im Sommer fast an jedem Wochenende. Allein diese Maßnahmen zur kurzfristigen Steuerung des Stromnetzes kosten heuer bis zu 150 Millionen Euro.
Die Eingriffe gab es früher auch.
Strebl: Ja, aber es sind in den vergangenen Jahren mehr geworden. Ich will jetzt die fossilen Kraftwerke nicht propagieren. Aber diese Kraftwerke kann man quasi per Knopfdruck steuern. Jetzt gibt es glücklicherweise sehr viel erneuerbare Energie, auch unsere Strategie ist der völlige Ausstieg aus Erdgas. Wind und Sonne kann man aber nicht auf Knopfdruck ein- und ausschalten.
Deshalb braucht es neue gesetzliche Rahmenbedingungen.
Zehetner: Es wäre müßig, über eine Kraftwerksstrategie zu diskutieren, wenn es gleichzeitig keine Möglichkeit gibt, in einer adäquaten Zeit eine Anlage genehmigen zu lassen. Das Elektrizitätswirtschaftsgesetz ist die Basis, aber es braucht auch das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz.
Strebl: Es geht darum, Versorgungssicherheit neu zu denken.
Also etwa insofern, dass nicht jeder Landesenergieversorger ein eigenes Back-up-Kraftwerk braucht?
Strebl: Es ist wichtig, dass diese Systeme marktwirtschaftlich gestaltet werden. Etwa durch Ausschreibungen.
Zehetner: Oder Auktionen.
Was verstehen Sie unter „marktwirtschaftlich gestalten“?
Strebl: Es soll keine staatliche Stelle anordnen, wie groß und in welcher Art das Sicherheits-System sein soll.
Aber die Feuerwehr rechnet sich ja auch nicht marktwirtschaftlich.
Strebl: Ja, in diesem Fall ist der Vergleich mit der Feuerwehr nicht ganz zulässig. Man kann das marktwirtschaftlich organisieren. Allerdings sollte es sich um erneuerbare Energie handeln. Und natürlich sollen auch die Kundinnen und Kunden mitgenommen werden.
Das sind viele „Allerdings“ und „Aber“ für eine „marktwirtschaftliche Lösung“. Und was heißt „Kunden mitnehmen“?
Zehetner: Es braucht mehr Aufklärung, um die Denkweise und das Verhalten der Konsumenten zu ändern.
Zum Beispiel?
Zehetner: In vielen Haushalten gibt es bereits Stromspeicher, aber nur sehr wenige verwenden diese so, dass sie das Netz – etwa zur Mittagsspitze – entlasten. Oft ist sogar das Gegenteil der Fall. Strom wird in das System eingespeist, wenn dieses ohnehin schon überlastet ist.
Die Waschmaschine soll also nicht zu den Spitzenzeiten in der Früh oder am Abend eingeschaltet werden.
Strebl: Die Waschmaschine ist nicht das Problem. Aber wenn jemand um 17 Uhr mit seinem E-Auto nach Hause kommt, will er, dass es nächsten Morgen aufgeladen ist. Und es ist ihm völlig egal, ob es sofort oder erst nach Mitternacht auflädt. Genauso kann man etwa eine Wärmepumpe zeitlich steuern. Die muss nicht zur Hauptverbrauchszeit laufen.
Zehetner: Mittlerweile gibt es Technologien, die das auch sehr einfach und autonom regeln.
Strebl: Und natürlich können auch gewisse Industrien in hohem Maße hier mithelfen. Etwa die Tourismusindustrie. Das Hallenbad, den Wellnessbereich kann man auch außerhalb der Spitzenzeiten heizen.
Eine freiwillige Energie-Feuerwehr wird nicht funktionieren.
Strebl: Es braucht dazu Anreize.
Oft heißt es „Anreiz“, gemeint sind aber Strafen.
Zehetner: Als Anreiz könnten Preissignale dienen. Es gibt netzdienliches und netzschädliches Verhalten. Und dieser Unterschied muss sich dann im Strompreis widerspiegeln.
Strebl: Ein Modell könnte sein, dass Stromversorger Zertifikate kaufen müssen. Und wenn diese ihre Kunden dazu bewegen können, netzdienlicher zu agieren, braucht es weniger Zertifikate.
Zehetner: Die Herausforderung einer Kraftwerksstrategie besteht darin, dass man Anreize schafft, um genügend Back-up-Kapazitäten zum günstigsten Preis zu generieren.
Aber irgendwie klingen beim Wort „Versorgungssicherheit“ schon auch „höhere Strompreise“ durch.
Strebl: Nein, das muss nicht mehr kosten. Wir zahlen ja jetzt schon wie gesagt 150 Millionen Euro für das Redispatching, also für nachträgliche Reparaturen der Stromleistung. Das kann man sich künftig sparen.
Statt dieser Reparaturen gibt es dann künftig sogenannte Back-up-Kraftwerke, die auch nicht umsonst sind.
Strebl: Aber diese Kraftwerke sind ja nicht nur für die Sicherheit, sondern auch für den Markt. Unterm Strich kostet das unseren Berechnungen nach nicht mehr.
Das Wiener „Back-up-Kraftwerk“ wäre dann das Gaskraftwerk in Simmering. Das muss man doch gar nicht neu bauen.
Strebl: Dieses Kraftwerk ist in die Jahre gekommen. Nicht, dass es bereits kaputt wäre. Aber wir müssen jetzt schon mit der Planung beginnen und es auf erneuerbares Gas umstellen. Wir brauchen diese Back-up-Kraftwerke künftig nur für wenige 100 Stunden pro Jahr. Nämlich in den Dunkelflauten, in denen es weder Sonne noch Wind gibt. Diese Wetterphänomene treten oft hintereinander auf.
Was heißt „dringend“?
Strebl: Wir werden Mitte der 2030er-Jahre auf ein Problem zusteuern. Das klingt nach sehr viel Zeit. In der Energiewirtschaft ist das aber übermorgen.
Von Gerhard Hofer
Die Presse