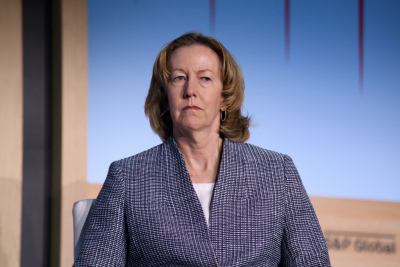Arabische Staaten investieren inzwischen bereits viel Geld in erneuerbare Energiequellen. Beim Übergang zu einer CO2-freien Welt stehen jedoch einige immer noch auf der Bremse. Wie passt das zusammen?
Beim Kampf gegen den Klimawandel will sogar das vom Bürgerkrieg verwüstete Syrien mitmachen. Der Prophet Mohammed habe Muslimen verboten, Bäume zu fällen und natürliche Ressourcen zu verschwenden, sagte der syrische Übergangspräsident, Ahmed al-Sharaa, jüngst bei einem internationalen Gipfeltreffen vor der Klimakonferenz COP30 im brasilianischen Belém. Syrien leide wegen des Klimawandels bereits unter einer schlimmen Dürre und brauche Investitionen in erneuerbare Energien. Sein Land wolle sich an den Bemühungen beteiligen, den Ausstoß von CO2 zu reduzieren, sagte Sharaa.
Auch andere arabische Spitzenpolitiker werden sich bei der UN-Klimakonferenz in Belém bis zum 21. November zu den Zielen der Pariser Klimakonferenz bekennen. Der Nahe Osten und Nordafrika gehören zu den Weltregionen, die besonders stark von der Erderwärmung betroffen sind: Um bis zu vier Grad werden die Temperaturen hier in den kommenden Jahrzehnten steigen. Wissenschaftler in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) maßen dieses Jahr erstmals eine Temperatur von fast 52 Grad im Mai. Elf der 17 Länder, die weltweit besonders unter Wassermangel zu leiden haben, liegen laut UN-Angaben in dieser Region.
Doch einige arabische Staaten bremsen beim Übergang zu einer CO2-freien Welt, weil sie möglichst lang von Einnahmen aus Öl und Gas für ihre Volkswirtschaften profitieren wollen. Der Nahe Osten lieferte nach Zahlen der Internationalen Energieagentur im vergangenen Jahr rund 30 Prozent der weltweiten Ölförderung und 17 Prozent des Erdgases. Der Export fossiler Brennstoffe ist die Haupteinnahmequelle für viele arabische Länder. Die Vorbereitung auf eine Zeit nach Öl und Gas läuft, doch die Abhängigkeit wird noch Jahre oder Jahrzehnte anhalten.
Zehn Milliarden Bäume
„Es gibt immer noch die Blockierer, allen voran Saudiarabien“, sagt Tobias Zumbrägel, Experte für Klimapolitik und Umweltschutz in der arabischen Welt. Zwar setze die Führung in Riad positive Zeichen. Im Rahmen der „Saudischen Grünen Initiative“ von 2021 will das Land seine CO2-Emissionen bis 2030 um 30 Prozent reduzieren und in den kommenden Jahrzehnten zehn Milliarden Bäume pflanzen. Dennoch sei erkennbar, „dass Saudiarabien der Hardliner bleibt und sich weigert, irgendwie dem Ausstieg aus fossilen Brennstoffen zuzustimmen“, sagte Zumbrägel, Wissenschaftler am Geographischen Institut der Universität Heidelberg, der „Presse“.
Statt sich vom Öl zu lösen, setzt Saudiarabien auf Technologien wie die CO2-Speicherung. Zwar ist dem saudischen Thronfolger, Mohammed bin Salman, klar, dass die Ölvorräte seines Königreichs irgendwann zur Neige gehen werden. Doch er wehrt sich gegen schnelle Schritte. Die Saudis „wollen alles nach ihrem Tempo machen“, sagt Zumbrägel. In Belém könnte Saudiarabien deshalb Vereinbarungen blockieren, erwartet der Experte.
Grüner Wasserstoff
Auch andere arabische Länder wie Kuwait zögern. Der Klimabeauftragte des erdgasreichen Emirats Katar, Ahmad Mohammed al-Sada, erklärte vor Beginn der COP30, es müsse einen „gerechten Übergang zu sauberer Energie“ geben. Die VAE, die vor zwei Jahren selbst Gastgeber der Weltklimakonferenz waren, zaudern ebenfalls. Sie investieren viel Geld in erneuerbare Energien, bauen gleichzeitig aber auch „das alte Business der Öl- und Gasproduktion weiter aus“, wie Zumbrägel sagt.
Zu den Klima-Vorreitern in der arabischen Welt zählt der Experte Marokko und Oman, weil diese Länder den grünen Wasserstoff ins Zentrum ihrer Politik gerückt haben. Oman sieht Westeuropa, Japan und Südkorea als künftige Abnehmer von grünem Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien wie Sonne und Wind gewonnen wird und deshalb als klimafreundliche Energiequelle der Zukunft gilt. Das Land an der Ostküste der Arabischen Halbinsel will bis zum Jahr 2050 rund 140 Milliarden Dollar in die Herstellung von grünem Wasserstoff stecken, inklusive einer klimafreundlichen Stromproduktion: Geplant sind 300 Millionen Solarpaneele und 10.000 Windturbinen.
Fehlende Abnehmer
Doch die arabischen Wasserstoffpioniere haben ein Problem: Es gibt noch nicht genug Abnehmer. In Europa werden Wasserstoffprojekte gestrichen, weil sie sich derzeit nicht rechnen. Arabische Länder fürchten deshalb um ihre Investitionen. „Man wird ein wenig nervös“, sagt Zumbrägel.
Für Marokko und Oman bietet die Weltklimakonferenz in Brasilien deshalb die Chance, für den Wasserstoff und ihre Projekte zu werben. Beide Länder werden die COP30 laut Zumbrägel „als Business-Format nutzen, um ihre Wasserstoff-Pläne und die internationalen Partnerschaften dafür weiter voranzutreiben“.
Von THOMAS SEIBERT
Die Presse