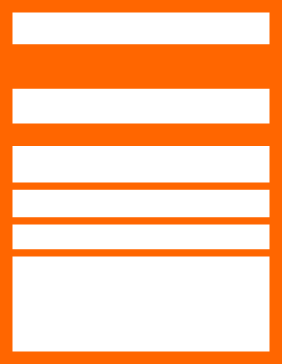Die Zukunft der lokalen Stromversorgung sehen viele in nachhaltigen Energiegemeinschaften. Ob sie funktionieren, hängt auch davon ab, wie verschiedene Interessen unter einen Hut gebracht werden.
Wenn sich Josef Walch an die Stromversorgung in seinen Kindheitstagen erinnert, dann tauchen vor seinem geistigen Auge flackernde Glühlampen auf, genervte Erwachsene und streitende Bauern. Denn das dörfliche Stromnetz war so schwach ausgelegt, dass schon ein Starkstromgebläse, mit dem ein Bauer sein Heu auf den Futterboden blies, die Stromspannung in die Knie zwingen konnte. „Zwei elektrische Großverbraucher durften gar nicht erst gleichzeitig eingeschaltet werden.“ Konflikte bei Strommangel sind dann vorprogrammiert.
Heute forscht Walch an der Fachhochschule Wiener Neustadt an nachhaltigen Energiegemeinschaften. Konkret leitet er dort das Projekt NETSE (Nutzerorientierte Entwicklung von Technologien und Services für Energiegemeinschaften). Es findet im Rahmen der Forschungsinitiative Green Energy Lab statt und wird via den Klima- und Energiefonds vom Klimaschutzministerium gefördert. Das Thema hat jedenfalls Déjà-vu-Potenzial. Denn auch heute können Konflikte auftreten, wenn man nicht um- und vorsichtig agiert.
Energiegemeinschaften sind in der Regel der Zusammenschluss von mehreren Erzeugern von Strom aus Photovoltaik, aber auch aus Wind oder Wasser und ein paar kleineren wie größeren Stromverbrauchern. Manchmal gibt es auch Stromspeicher in den Energiegemeinschaften, etwa Solar- oder Elektroautobatterien oder Warmwasserspeicher, die mit Wärmepumpen aufgeheizt werden können.
Konfliktfreie Aufteilung
Nachhaltig meint in diesem Sinne nicht nur, dass Energiegemeinschaften erneuerbare Energie erzeugen und damit per definitionem schon nachhaltig wären, sondern die Mitglieder den (billigeren) Strom untereinander auch einfach aufteilen können, damit es gerecht, effizient und konfliktfrei zugeht.
Das kann ja nicht so schwer sein, könnte man meinen. Wenn Strom aus Sonne, Wind oder Wasser anfällt, dann wird er auf die Mitglieder verteilt. Bei Überangebot wird an das Netz verkauft, bei Unterversorgung aus dem Netz zugekauft.
Aber, so lernt man schnell, so einfach ist das nicht. Zum einen braucht man einmal sehr genaue Messgeräte – sogenannte Smart Meters, die im Viertelstundentakt angeben, wie viel Strom erzeugt und verbraucht wird. Die gemessenen Viertelstundenstromverbräuche und die erzeugten Strommengen müssen zentral erfasst, bilanziert und verrechnet werden.
Dann braucht man eine Regelung, die die Stromaufteilung optimiert. Denn wer bekommt wie viel von dem billigeren Strom? Berühmtes Beispiel: die Waschmaschine. „Die kann man auch zu Mittag automatisch einschalten, wenn viel Solarstrom anfällt und sie billig betrieben werden kann“, sagt Walch.
Nerds und Lokalmatadore
Aber wie sieht das dann aus, wenn viele genau das wollen, es aber nur wenig billigen Strom gibt? Oder welchen Tarif gibt es für Mitglieder an der E-Tankstelle? Wer darf wie oft tanken? Und, noch schwieriger: Was macht ein Bäcker? Der braucht Strom für seinen Backofen um zwei Uhr in der Früh. Zahlt sich für ihn eine Teilnahme an einer Energiegemeinschaft, die Strom aus Photovoltaik erzeugt, überhaupt aus? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen?
Um diese Fragen beantworten zu können, muss man zuerst die Nutzerinnen und Nutzer in Energiegemeinschaften kennen, ihre Motive und Erwartungen. Das Interessante dabei: Es wird darauf nicht nur eine Antwort geben. „Es gibt verschiedene Nutzertypen“, sagt Walch. Da wären zuerst die Nerds. Sie interessiert jedes technische Detail. Sie wissen alles über die rechtlichen Rahmenbedingungen, Einspeisetarife und die technischen Möglichkeiten im Detail.
Dann gibt es die Nutzer, die mit all dem Technikkram nichts zu tun haben wollen und für die die „Usability“, also die möglichst einfache Bedienbarkeit plus ordentliche Einspareffekte im Vordergrund stehen. Und dann gibt es noch den Typ „Gemeinschaftssinn“. Hier steht das neue Energieversorgungsmodell im Vordergrund – die Vermeidung von CO2, die neue Autonomie und die Möglichkeiten des Lokalen.
Energiegemeinschaft wird daher nicht Energiegemeinschaft sein. „Da wollen wir beraten“, sagt Walch, „schon bei der Gründung.“ Um beim Beispiel zu bleiben: Bäckerei – ja oder nein? Und wenn ja, unter welchen Umständen?
Vielfältige Antworten sind aus dem Projekt NETSE, das noch bis Jahresende läuft, zu erwarten. Der erste Use-Case ist jedenfalls eine regionale Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft in Wieselburg, in der die Forscherinnen und Forscher gerade Motivlage und Erwartungen erheben. Aus den Ergebnissen könnten dann andere Gründungen von Energiegemeinschaften profitieren.
Boom an Gemeinschaften
Davon gibt es in Niederösterreich bereits viele. Mehr als 40 Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften sind etwa gemeinsam mit dem Serviceunternehmen Energiezukunft Niederösterreich im Entstehen. An dem interdisziplinären Projektteam sind neben der FH Wiener Neustadt unter anderem auch das Kompetenzzentrum Bioenergy und Sustainable Technology (BEST), das Austrian Institute of Technology (AIT) und die 4ward Energy Research GmbH beteiligt.
„Wir machen die Begleitforschung und werden unsere Expertise einbringen“, sagt Walch. „Damit wir möglichst viele Energiegemeinschaften erfolgreich auf den Weg bringen.“
Der Standard