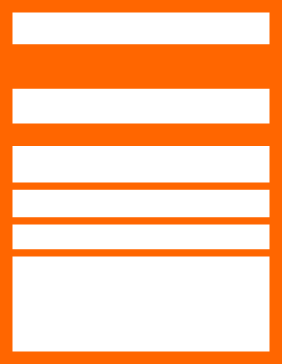Bis Ende 2022 sollen die Gasimporte aus Russland um zwei Drittel sinken. Das sieht ein Plan der EU vor. Eine Studie zeigt nun, dass dies technisch ginge, aber ungemein sportlich wäre.
Im Moment scheint alles einer Idee untergeordnet zu sein: sich möglichst rasch aus dem Würgegriff Russlands bei Gas zu befreien, koste es, was es wolle. Die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen hat vor knapp einem Monat den Plan öffentlich gemacht, bis Ende des Jahres die russischen Gaseinfuhren nach Europa um zwei Drittel zu reduzieren. Ist das realistisch?
Die international tätige Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) hat die getroffenen Annahmen einem Härtetest unterzogen. Quintessenz der Analyse: Das Vorhaben ist technisch machbar, aber sehr herausfordernd.
Kurz die Eckdaten, um die es geht. Die EU-27 importieren jährlich rund 150 Milliarden Kubikmeter (m3) Erdgas aus Russland. Das sind etwa 40 Prozent der auf dem Kontinent insgesamt verbrauchten rund 380 Milliarden m3 pro Jahr. Zwei Drittel der Menge zu reduzieren hieße, 100 Milliarden m3 in den verbleibenden gut acht Monaten durch andere Lieferanten, andere Energieträger zu ersetzen – oder einen Teil des bisher verbrauchten Gases einzusparen.
Tatsächlich sehen die Brüsseler Pläne vor, dass zehn Milliarden m3 zusätzliches Pipelinegas aus Ländern wie Norwegen, Algerien oder Aserbaidschan nach Europa kommen. Den Großteil der entstehenden Lücke – bis zu 50 Milliarden m3 – soll mit zusätzlichen Importen von Flüssiggas (Liquefied Natural Gas, LNG) gedeckt werden, wobei insbesondere an die USA und Katar als Lieferländer gedacht wird.
Mutmacher
Der Rest soll durch Hebung der Inlandsgasproduktion, soweit eben möglich, und Forcierung etwa von Biogas gelingen. Und, nicht zu vergessen, auch der sparsamere Umgang mit Gas soll zu einem Minderverbrauch führen, wobei aber außer Deutschland mit der Aktivierung der Frühwarnstufe Ende der Vorwoche noch niemand einen offiziellen Aufruf zum Energiesparen lanciert hat.
„In der EU hat man eine gesamtvolumetrische Betrachtung angestellt: Was fällt weg, und wie lassen sich diese Mengen kompensieren,“ sagt Sönke Lorenz, Energieexperte, Partner und Associate Director von BCG in Berlin, dem STANDARD. „In der Realität wird man Abstriche davon machen müssen, weil der nächste Winter kälter sein kann als der vergangene und wir schon allein deshalb mehr Gas brauchen könnten.“ Auch andere Annahmen seien zu hinterfragen, etwa die hundertprozentige Verfügbarkeit der Pipeline-Infrastruktur zu jeder Zeit.
„Ich sehe in dem Ziel, die Abhängigkeit Europas von russischen Gaslieferungen kurzfristig um zwei Drittel zu reduzieren, den Versuch, Mut zu machen. Probieren wir es, lass uns die Flinte nicht gleich ins Korn werfen“, sagt Lorenz. Das zusätzliche Pipelinegas, das man in der EU aufstellen will, sei mit zehn Milliarden m3 „ein Tropfen auf den heißen Stein“ – gemessen an den 150 Milliarden m3, die Russland derzeit stellt. Mehr ins Gewicht fällt LNG, wobei man da auch schönfärbt.
„Die 50 Milliarden m3 sind so gerechnet, dass man die Maximalkapazitäten der innereuropäischen Pipelines angesetzt hat, die zu den noch verfügbaren LNG-Terminals führen“, sagt Lorenz. Genau in dieser Annahme liege das Problem. Europa sei gastechnisch zweigeteilt. Deutschland, Österreich und der ganze Ostblock sind pipelineversorgt; Länder wie Spanien oder Portugal haben sich für LNG entschieden und Flüssiggasterminals gebaut. Zwischen beiden Systemen gibt es nur moderate Kapazitäten, das heißt, der Engpass liegt weniger bei den Anlandeterminals, wo das auf minus 162 Grad gekühlte LNG in gasförmigen Zustand transformiert und in Pipelines eingespeist wird, sondern genau bei den Pipelines.
Hoher Preis
„Realistisch sind vielleicht 40 bis 45 Milliarden m3, die man mit LNG abdecken kann. Die eine oder andere Leitungsstörung muss immer einkalkuliert werden“, sagt Lorenz.
Dass sich Europa mittelfristig ausreichend mit LNG eindecken kann, glaubt der Energieexperte schon, auch wenn der Preis sehr hoch sein wird. Lorenz: „Die Menge an LNG, die wir jetzt allein kurzfristig brauchen, ist doppelt so groß wie der Bedarf, den Japan nach der tsunamibedingten Nuklearkatastrophe von Fukushima hatte.“
Der Standard