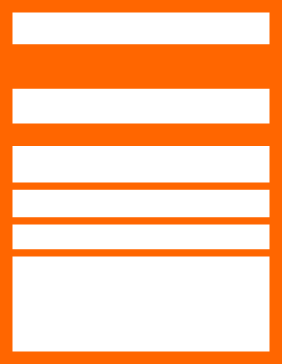Alle reden im deutschen Wahlkampf über Klimaschutz. Aber eine Frage bleibt meistens offen: Wenn sich die Republik elektrifiziert, woher kommt dann der zusätzliche Strom? Kleine Vermessung eines ziemlich großen Problems.
@LR von JÜRGEN STREIHAMMER UND MATTHIAS AUER
Neckarwestheim. Isar. Emsland. Das sind die Namen einer Gemeinde, eines Flusses und eines Landkreises. Neckarwestheim. Isar. Emsland. Das sind die Codewörter für eine Zäsur, nämlich die Namen jener drei Atomkraftwerke, die Ende nächsten Jahres als letzte vom Netz gehen sollen.
Der Ausstieg aus der Kernenergie ist aber nur der erste Akt eines beispiellosen Umbruchs, den Europas größte Volkswirtschaft vollziehen wird. Oder zumindest vollziehen will. Spätestens 2038, vermutlich früher, sollen auch die Schaufelräder, groß wie Wohnhäuser, verschwinden, die in unwirklichen Mondlandschaften nach schmutzigem Rohstoff graben: Das Ende der Braunkohle, ihrer Förderung und ihrer Verstromung: Das ist der zweite Akt.
Das Rückgrat der Energiewende. Die Republik will keine Kohle verfeuern und keine Atome spalten. Zugleich verschreibt sie sich immer ehrgeizigeren nationalen Klimazielen. Deutschland soll schon 2045 CO2-neutral sein, nicht erst 2050, und schon bis 2030 die CO2-Emissionen um 65 Prozent im Vergleich zu 1990 drücken. In den schwarz-roten Gesetzestexten, eilig im Frühjahr verfasst, führte die Angst die Feder – weniger vor dem Klimawandel, mehr vor den Grünen. Aber zwischen Anspruch und Wirklichkeit dieser Energiewende klafft eine Lücke. Und sie ist gewaltig.
Man kann sich ihr annähern: 2030 dürfte der Strombedarf von 580 auf 655 Terawattstunden im Jahr klettern. Oder anders: Deutschland wird in nur neun Jahren in etwa so viel zusätzlichen Strom benötigen, wie die Republik Österreich heute verbraucht. Und das ist nur der Anfang. Eine CO2-neutrale Chemieindustrie würde eines Tages fast so viel Strom verschlingen wie ganz Deutschland heute. Zumindest behaupten das Branchenvertreter. Sicher ist: Die Republik giert nach grüner Elektrizität. Aber während die Parteien in diesem Wahlkampf gern darüber diskutieren, ob und welches Ablaufdatum sie auf den Verbrennermotor kleben wollen, über Sinn und Unsinn von Verboten und wie hoch der CO2-Preis sein soll, spielt eine andere Frage nur eine Nebenrolle: Wenn 2030 Millionen Elektroautos rollen und Wärmepumpen surren und die Industrie mit Wasserstoff hantiert: Woher kommt dann eigentlich der Strom? Und zwar auch an Tagen, an denen am trüben Himmel nicht einmal ein laues Lüftchen weht?
Die Stromtrasse Südlink ist eine Hauptschlagader der Energiewende. Sie soll auf einer Länge von rund 700 Kilometern grünen Gleichstrom aus dem windreichen Norden, auch aus den Offshore-Parks auf hoher See, in die Industriezentren im Süden tragen und eigentlich Ende 2022, zeitgleich mit dem Atomausstieg, ans Netz gehen. Das war einmal die Idee. Inzwischen ist Ende 2026 das Ziel, wobei auch dieser Zeitplan „sehr ambitioniert“ ist, wie Tim Meyerjürgens zur „Presse am Sonntag“ sagt. Bis 2027 sei jedenfalls realistisch. Meyerjürgens ist Geschäftsführer von Tennet, jenem Konzern, der gemeinsam mit Transnet BW die gewaltigen Stromtrassen Südlink und Südostlink errichtet. Wer verstehen will, was sich in Deutschland ändern sollte, damit die Energiewende gelingt, muss auch mit ihm reden.
Ein Akzeptanzproblem. Die deutsche Energiewende plagt ein Akzeptanzproblem. Aus der Vogelperspektive sieht man es nicht. Das Thema Klimaschutz rangiert weit oben in der Hitparade der wichtigsten Themen. Dass es viel mehr Windräder und Fotovoltaikanlagen braucht, ist fast Konsens. Aber in der Nahaufnahme zerfällt die Einigkeit in Tausende Einzelkonflikte. Oft geht der Riss mitten durch grün-affine NGOs. Das Projekt Südlink zeigt das Dilemma wie unter dem Brennglas.
„Deutschland“, sagt Meyerjürgens, „ist extrem dicht besiedelt.“ Das schuf bei Südlink überall entlang der Trassen „Betroffenheiten“. Hunderte Bürgerinitiativen protestierten. Irgendwann schwenkte die Politik um. Die Stromhauptschlagader sollte nun unter der Erde verlaufen, Kabel die vorgesehenen Freileitungen ablösen. „Das hat uns in der Planung drei Jahre zurückgeworfen.“ Die Politik habe es gut gemeint: Sie wollte ein Akzeptanzproblem beseitigen und das Verfahren beschleunigen. Aber die Konflikte verlagerten sich nur. Zuerst klagte die Allgemeinheit über den Eingriff in ihr Landschaftsbild, dann die Bauern über jenen in ihre Böden. Nichts ging schneller.
Interessenkonflikte überall. Oft, nicht immer, protestierte die Lokalpolitik, falls die Leitung ihr Territorium berührt. Das Parteibuch spielt dabei nur eine Nebenrolle. „Wenn vor Ort Bürgermeister oder Landräte das Projekt in Zweifel ziehen, dann kostet uns das erst mal Vertrauen.“ Als der Korridor für Südlink nach vielen Jahren endlich festgelegt war, freuten sich öffentlich jene, die von der Trasse unberührt blieben. Das schürte Neiddebatten. Das Land Thüringen klagte gegen den Trassenverlauf. Dort sitzen auch die Grünen in der Regierung.
Im Zweifel herrscht das Florianiprinzip. Klimaschutz ja, aber nicht vor meiner Haustür. Und lieber auch nicht in meinem Portemonnaie. Wenn er sich etwas wünschen dürfte, sagt Meyerjürgens, dann dass die „gesellschaftliche Notwendigkeit“ der Energiewende auf allen Ebenen, nicht nur ganz oben, erkannt wird und dass es die Politik ehrlich macht: Die Energiewende lässt sich nicht unsichtbar vollziehen, „natürlich wird man das sehen“.
Klimakanzlerin? Es gibt dieses Bild von Angela Merkel, wie sie auf Grönland vor immer dünner werdendem Eis posiert. Das Porträt einer „Klimakanzlerin“, 14 Jahre alt. Aber Merkels Energiewende ist, Stand 2021, Stückwerk. Teures Stückwerk. In keinem anderen Land Europas sind die Strompreise höher als in der Bundesrepublik. Die Deutschen bezahlen im Schnitt fast doppelt so viel wie noch zur Jahrtausendwende. Das liegt vor allem an der sogenannten Ökostrom-Förderung (EEG) und an den steigenden Kosten für die Stabilisierung der Stromnetze. Merkels Klimabilanz ist kein Schwarz-Weiß-Gemälde. Der Anteil erneuerbaren Energien am Stromverbrauch betrug zehn Prozent, als sie 2005 ins Amt kam. Mittlerweile erzeugen die Deutschen 45 Prozent ihres Strombedarfs mit der Hilfe von Wind, Sonne und Wasser. Das ist auch ein Erfolg. Aber das Tempo des Ausbaus reicht nicht, nicht, um die Ziele zu erreichen.
So sieht das Wilfried Rickels. Er leitet das Forschungszentrum Global Commons und Klimapolitik am Institut für Weltwirtschaft. „Das größte Hindernis für die Energiewende liegt in den langen Planungsverfahren“, sagt er zur „Presse am Sonntag“: „Man muss das reformieren.“ Planung und Genehmigung eines einzigen Windrads fressen im Schnitt vier bis sechs Jahre. Für Großprojekte wie Südlink dauern die Verfahren noch länger, sechs bis zehn Jahre. Und wenn Deutschland die Bahnstrecke München-Berlin erneuert, um zwei Stunden Fahrtzeit zu gewinnen, dann vergehen 26 Jahre bis zur Eröffnung. Als Noch-Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) im Juli mit Journalisten über die Berliner Spree tuckerte, sagte er einen griffigen Satz: „Wir sind das Land, in dem alles endlos lang dauert.“
Im Zweifel bremst die Regelwut. „Die Verfahren sind deutlich komplexer geworden“, sagt Meyerjürgens von Tennet. Und wenn nach Jahren der Prüfung dann genehmigt wird, „hat sich technisch schon wieder so viel geändert, dass die Pläne wieder neu angepasst werden müssen.“
Die Politik war nicht tatenlos. Sie hat im Vorjahr ein Investitionsbeschleunigungsgesetz auf den Weg gebracht. Aber auch aus Sicht von Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet reicht das nicht. Er macht die Beschleunigung von Verfahren zum Wahlkampfversprechen. Natürlich, sexy ist das Thema nicht. Es kreist um sperrige Begriffe wie „Beschränkung des Verbandsklagerechts“ oder darum, dass gerichtliche Klagen nur jenen möglich sein sollten, „die auch am Verwaltungsverfahren beteiligt waren“. Die Genehmigungsdauer von Windrädern will Laschet auf sechs Monate drücken. Könnte schwierig werden.
Zum Gesamtbild gehört freilich, dass in Bayern und auch in Nordrhein-Westfalen, wo Laschet als Ministerpräsident regiert, Mindestabstandsregeln zum bebauten Gebiet den Windkraftausbau bremsen. Aber auch in Baden-Württemberg, wo der erste und einzige grüne Landesregierungschef der Republik regiert, kommt der Ausbau kaum voran. Um die eigenen Ziele zu erreichen, müsste Deutschland Schätzungen zufolge alleine 1500 neue Windräder an Land errichten. Und zwar pro Jahr. Einen Teil kann „Repowering“, leisten, also das Ersetzen von alten durch stärkere Anlagen. Aber selbst dieser Austausch verschlingt Jahre. Und es kommt vor, dass sich trotz bestehender Windräder in der Zwischenzeit Vögel wie der Rotmilan oder der Seeadler angesiedelt haben, was die Genehmigung verzögert oder verhindert. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer führt in einem Positionspapier einige solcher Beispiele an.
Der Ausbau ging lang nur noch am offenen Meer kräftig voran. Also bisher. In diesem Jahr wird kein einziges weiteres Offshore-Windrad errichtet. Das Tempo bei der Errichtung an Land zog 2021 nur sanft an und ist noch immer deutlich zu langsam.
Das ist auch ein wirtschaftliches Problem: Seit 2016 haben 50.000 Menschen in der deutschen Windkraftbranche ihren Arbeitsplatz verloren. Die Solarbranche entging nur knapp einem ähnlichen Fiasko. In letzter Sekunde konnte im Vorjahr ein geplanter Förderstopp für Fotovoltaikanlagen verhindert werden. Die Grünen fordern nun, auf jedes neue Dach so eine Anlage zu setzen und zwei Prozent der Landesfläche für Windkraft auszuweisen.
Fast alle Parteien bekennen sich zum 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens und zu den nationalen Vorgaben. Nur die AfD tanzt aus der Reihe. Aber zugleich taugt kein einziges Wahlprogramm, um die eigenen Vorgaben zu erfüllen. Nicht einmal die Grünen liefern „schlüssige Konzepte, um die Ziele bis 2030 vollständig zu erreichen“, sagt Claudia Kemfert, Ökonomin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sie fordert die Politiker auf, die „Gespensterdebatten“ zu beenden und endlich in die Gänge zu kommen. Das sitzt. Im ersten Halbjahr 2021 stieg die Produktion der fossilen Energieträger stark an. Die Erneuerbaren verloren ein Prozent Marktanteil, heißt es im Bericht der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen.
Spätestens Ende 2021 wird der zögerliche Zubau der Ökostrom-Anlagen den schrittweisen Wegfall der AKW nicht mehr kompensieren können. Was dann passiert, lässt sich in den jüngeren Energiebilanzen bereits ablesen: Deutschland, das in den vergangenen 20 Jahren stets Strom ins Ausland verkauft hat, droht zum Stromimporteur zu werden. Im Jahr 2020 brach der Exportüberschuss bereits um fast die Hälfte auf 21 Terawattstunden ein.
Atomstrom aus Frankreich. Kippt die Strombilanz, muss sich die Republik nach verlässlichen Lieferanten umsehen, die auch dann Strom schicken, wenn im Winter die berüchtigte Dunkelflaute die Produktion der Wind- und Solaranlagen beeinträchtigt. Ganz oben auf der Liste der Stromexporteure der Zukunft steht Frankreich.
Der Haken: Elektrizität aus der Republique francaise stammt vorwiegend aus Atomkraftwerken. Und anders als Berlin denkt Paris nicht darüber nach, das bald zu ändern. Es ist also wahrscheinlich, dass Deutschland seine Energiewende auch deshalb voranbringen wird, weil es bei Atomstrom aus dem Ausland ein Auge zudrückt. Österreich ist in einer ähnlichen Situation. Auch hier verbrauchen Stromkunden im Osten und Süden an vielen Tagen Elektrizität aus tschechischen, slowakischen und slowenischen Kernkraftwerken, die sie lautstark bekämpfen.
Selbst der Abschied von der Kohle ist in Deutschland nicht in Stein gemeißelt. Denn um die Versorgungssicherheit auch dann zu gewährleisten, wenn reihenweise konventionelle Kraftwerke dichtmachen müssen, reichen die wetterabhängigen Ökostromanlagen nicht aus. Die Netzbetreiber fordern Anreize für den Bau von Gaskraftwerken, die im Notfall einspringen sollen, um die Netze zu stabilisieren. Funktioniert das nicht, muss die Bundesnetzagentur am Ende Kohlekraftwerke reanimieren, also betriebsbereit halten, die eben erst stillgelegt wurden.
Hoffnungslos ist die Lage nicht. Beispiel: Heuer vernetzten sich die Energiemärkte von Deutschland und Norwegen. Die Stromtrasse Nordlink senkt die Abhängigkeit der Norweger von der Wasser- und die der Deutschen von der Windkraft. Spätestens 2027 wird auch im Südlink Strom fließen. Aber ein Grundproblem bleibt, das Meyerjürgens in einen Satz fasst: „Was wir bisher geplant haben in Deutschland, reicht einfach nicht.“ Und die Uhr tickt.
Die Presse